Zur Buchvorstellung // Zur Buchserie
Leseprobe aus Kapitel 12 „Feuerland“:
In Puerto Natales rüsten wir uns für die bevorstehenden Wochen. Unser Plan: ein Segeltörn durch die „Tierra del Fuego“ – Feuerland. Unser Ziel: Kap Hoorn. Routiniert bereiten wir uns und das Schiff auf die Zeit in der Wildnis vor, in der wir ganz auf uns gestellt sein werden. Obwohl auch im Sommer heftige Stürme die Südspitze Südamerikas heimsuchen, können wir jetzt, im Januar, zumindest mit langen Tagen und erträglichen Temperaturen rechnen. Die größte Sicherheit beim Segeln in diesem Gebiet aber ist ausreichend Zeit. Und die haben wir uns genommen für die 600-Seemeilen-Strecke von Puerto Natales ums Kap Hoorn nach Puerto Williams. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass wir uns in diese windigste Ecke der Welt wagen wollen. Beinahe wäre es jedoch unser letztes Mal geworden…Unsere Crew ist komplett, wir legen ab. An Bord: Hans, der auf der Freydis bereits um die beiden südlichen Kaps von Afrika (Kap Agulhas und Kap der Guten Hoffnung) gesegelt ist und außer uns als Einziger über genügend Blauwasser-Erfahrung für ein solches Revier verfügt. Ferner unser Frauenpaar Elisabeth und Elke, beides Psychotherapeutinnen. Auf der Ostsee haben sie ein kleines Boot. Und schließlich Inge mit ihrem Verlobten Sigi. Sie arbeitet als Segellehrerin auf Binnengewässern, er, Finanzberater in Dresden, stammt vom Bodensee.
Gleich beim Überqueren des Golfo Almirante stellt uns das Wetter auf die Probe. Stürmischer Wind schräg von vorn bricht mit Macht über uns herein. Die Crew muss rasch mit der Freydis vertraut gemacht werden: Elke steht am Ruder, Hans am Mast, Sigi und Inge an den Winschen und Elisabeth an der Karte. Mit dichtgeknallten, stark gerefften Segeln laufen wir gegen eine kurze, hackige See an. Da passiert’s, querab der Isla Focus! Vielleicht hat Sigi mit zu viel Elan die Riesenwinsch gekurbelt, vielleicht Erich zu spät „Stop!“ gebrüllt, vielleicht war das Segel nicht gut genug: Mit lautem Knall explodiert die Genua. Was eben noch ein nagelneues Segel war, ist bloß noch ein nutzloses Stoffknäuel: Nicht die Nähte sind gerissen – das ließe sich reparieren –, sondern das Tuch, gleich mehrfach durch alle Bahnen!
Trotzdem erreichen wir rechtzeitig zum Tidenwechsel den Canal Kirke (von Juan Ladrillero 1557 entdeckt). Erich hält zu meinem Entsetzen auf den „Malpaso“, das schlechteste und engste der drei Nadelöhre, zu. Mit bis zu 14 Knoten zwängt sich hier das Wasser zwischen steilen Klippen hindurch. Vor 16 Jahren haben mir schon bei der Passage des breitesten „paso“ die Haare zu Berge gestanden! Wie ein Wildwasserkanu wird die Freydis durch schäumende Wirbel gerissen. Gewaltige Strudel drohen das Boot querzuschlagen und gegen die Felsen zu rammen. Wir halten den Atem an. Wie von Geisterhand geleitet, erreicht das Schiff auch diesmal unbeschadet ruhigeres Wasser. Der Skipper freut sich über seine gelungene Einlage – aber nicht lange.
In der Nähe eines quer verlaufenden Gebirgszuges, auf den wir zuhalten, scheint das Wasser noch viel heftiger zu kochen: meterhoch wird es aufgepeitscht. Plötzlich treffen uns Williwaws, orkanartige Fallböen, mit solcher Wucht, dass das Großsegel aus den Lieken zu reißen beginnt. Mit Mühe und Not können wir das Tuch herunterzerren. Nur für ein paar Mastrutscher kommt die Rettung zu spät, sie sind gebrochen. Unter Maschine quälen wir uns vorwärts, fieberhaft nach einem halbwegs geschützten Ankerplatz Ausschau haltend. Doch überall nur schrundige Steilküste, nirgends eine Bucht, in der das Boot in den Orkanböen, die aus den unterschiedlichsten Richtungen auf uns niedersausen, vor Anker frei schwojen könnte. Wir nähern uns dem Ancon sin Salida, zu deutsch „Winkel ohne Ausweg“ – eine Art Blinddarm am Ende des Fjords, von Ladrillero so genannt, weil es dort bei Nordweststurm für ein Segelboot keine Entkommen gibt.
Doch gerade dieser „Winkel“ erweist sich für uns nicht als Falle, sondern als ideales Schlupfloch. Hinter einem der Inselchen am Scheitel des Ancon öffnet sich vor uns eine kleine trichterförmige Sandbucht (52°10,9’S,073°17,1’W) mit gutem Ankergrund, die in keiner Karte verzeichnet ist.
Inge, nach dem Inferno völlig erledigt, fällt in Sigis tröstende Arme. Zur allgemeinen Entspannung hören wir Musik, schauen einer schwarzweißen Andengans zu, die ihre Jungen am Ufer entlang spazieren führt. In der Nacht beleuchtet der Mond über düsteren Hügeln dahinhuschende Wolken und verwandelt die in Kaskaden von den Hängen herabstürzenden Wasser in pures Silber.
Nach einem kurzen Intermezzo mit Winddrehung auf Südwest und Wetterbesserung bläst es am Morgen erneut aus Nordwest. Der Zeiger des Barografen kritzelt sich in den Abgrund. Eine neue Front zieht durch, unentwegt pfeift der Sturm über die Insel. Wir sind heilfroh, in der Abdeckung zu liegen! Hier gelingt es uns sogar, die zerrissene Genua gegen die einzig verbliebene, leider wesentlich kleinere Genua auszuwechseln. Hans vollbringt das Wunder in der Mastspitze. Fast drei Tage liegen wir in dieser verwunschenen Nische, warten auf Wetterbesserung und nutzen die Zeit zu ausgiebigen Landgängen über das wilde Eiland. Nie werde ich seine windgebeugten, verkrüppelten Büsche und Bäume vergessen, deren Kronen alle nach Nordosten weisen, seine schwammigen Moorwiesen voller kleiner Blüten und Beeren, seine Schilffelder und vor allem seine unergründlichen, dunklen Seen. Als ich nicht länger widerstehen kann und schließlich in einem von ihnen bade, habe ich es nur ein paar langen Wurzeln, die sich vom torfigen Ufer aus in meine Nähe reckten, zu verdanken, dass man mich nicht in 5000 Jahren als Moorleiche herausfischt.
Im Smith-Kanal bläst uns danach wieder Starkwind mit Nieselregen auf die Nase, nur gelegentlich erhellen Regenbögen oder Sonnenstrahlen die düstere Stimmung des patagonisch-feuerländischen Sommers. Als hätte die Zeit hier stillgestanden, ragt noch immer mitten im Kanal das große rostige Wrack aus dem Wasser, an dem wir schon vor 16 Jahren vorbeigesegelt sind. Bei der Isla Tamar haben wir den Wind endlich im Rücken. Wir lösen die Reffs, baumen das Vorsegel aus und rauschen in der Finsternis durch den Paso del Mar, den westlichen Teil der von Fernando Magellan 1520 entdeckten Verbindung zwischen Atlantischem und Pazifischem Ozean, die wir bei Kap Edgeworth wieder verlassen.
Hatte sich für Magellan das Land südlich der von ihm entdeckten Straße noch als ein zusammenhängendes „Feuerland“ gezeigt, so offenbarte es sich dem Freibeuter Francis Drake auf der zweiten Erdumsegelung 1577 bereits als ein Labyrinth aus Inseln und Kanälen. Nachweislich besuchte er Eilande südlich der Magellan-Straße – darunter höchstwahrscheinlich auch die Kap Hoorn-Insel.
Im Canal Barbara quälen wir unser Schiff mit voller Motorkraft gegen den Ebbstrom durch die Engen. Aus dem Seno Helado leuchtet uns zwar verheißungsvoll die grellweiße Zunge des 1350 Meter hohen Gletschers der Isla Santa Inés entgegen, Schutz für die Nacht suchen wir jedoch erst in der Bahía Bedford, und das zusammen mit Scharen von Dampfschiffenten. Mit ihren Stummelflügeln wirbeln sie wie kleine Schaufelraddampfer durchs Wasser und sind dabei so schnell, dass nicht einmal „Superdampfschiffente“ Hans beim Ausbringen der Festmacherleinen im Dingi mithalten kann.
Frühmorgens passieren wir den Einschnitt Punta Dresden, in dem der kleine Kreuzer Dresden, das einzige noch übrig gebliebene Schiff vom Geschwader des Vizeadmirals Graf Spee nach der Seeschlacht bei den Falkland-Inseln im Ersten Weltkrieg, ein erstes Versteck fand. Dass die Dresden im Inselgewirr Feuerlands lange unentdeckt bleiben konnte, beweist, wie weitläufig und unübersichtlich dieses von allen Schiffen der Welt seit jeher am meisten gefürchtete, auch heute noch teilweise unvermessene Gebiet ist.
Mit dem Verlassen der Magellan-Straße wagen wir uns auf verbotenes Terrain, denn damit weichen wir von der offiziell vorgeschriebenen Route ab. Von nun an segeln wir ohne Genehmigung der chilenischen Marine auf eigenes Risiko. Zwar tolerieren die Behörden manchen eigenmächtigen Schlenker der Yachties, aber wehe, es passiert etwas. Dann drohen Geldstrafen, Gefängnis und die Beschlagnahmung des Schiffes. Wir müssen also vorsichtig sein in diesen nur vage vermessenen Gewässern. Der Grund für unsere Kursänderung ist ein ganz besonderes Ziel, das wir uns auf unserem Weg zum Kap Hoorn gesteckt haben: die Isla Noir, eine kleine Insel weit draußen vor der Küste, auf der es laut Seehandbuch einen geschützten Ankerplatz geben soll. Aufgrund ihrer isolierten Lage – eineinhalb Breitengrade nördlich und 250 Seemeilen westlich vom Kap Hoorn – vermuten wir dort noch unverfälschte Natur mit reichem Tierleben.
Dreißig Seemeilen sind es bis zur Isla Noir, also nur ein kleiner Tagestörn. Der allerdings hat es in sich, laut Alberto M. De Agostini, 1924: „Zwischen der Küste und der Schwarzinsel (Isla Noir)… dehnt sich eine Kette von klippenreichen Untiefen, welche die Strecke im Verein mit dem Wüten des Meeres und der Winde überaus gefahrvoll machen. Kein Schiff wagt dort eine Durchfahrt. Es ist das unbestrittene Reich der Seelöwen und der in Legionen hier lebenden Pinguine. Wohl landen zuweilen Robbenjäger, doch viele sind es nicht, die wiederkehren und ihre tollkühnen Abenteuer berichten können.“
Wir haben zunächst fantastische Sicht und können unser Ziel schon von weitem erkennen. Mittags trübt es sich stark ein, die Luft wird immer schwüler, der Wind nimmt kontinuierlich zu. Eine Aufgleitfront? Ein Blick auf die abknickende Barokurve bestätigt den Verdacht. Wir behalten den Kurs bei, reffen aber vorsorglich. Die Sonne ist nur noch als fahle Scheibe zu erkennen, die Inseln um uns herum verschwinden im Dunst. Eine hohe Altsee aus Südwest fordert erste Opfer der Seekrankheit. Als wir den Nordostzipfel der Insel zu fassen bekommen, hat sich der Wind bereits zum Sturm ausgewachsen. Die Ankerbucht Rada Noir, die in der einzig erhältlichen Spezialkarte dieser Insel eingezeichnet ist und die wir ansteuern, erweist sich als völlig ungeeignet für die Freydis: viel zu ausgesetzt und tief, fast offenes Meer, überall weiße Schaumkronen. Nur große Schiffe können hier einen gewissen Schutz vor Winden aus Nordwest bis Südwest finden. Eskortiert von Pinguinen, Kormoranen, Seeschwalben und Albatrossen hangeln wir uns an der Felsküste entlang und halten konzentriert Ausschau nach blinden Klippen, die sich oft nur durch brechende Seen verraten, vor allem aber nach einem geeigneten Schlupfloch. Wir entdecken eine kleine Einbuchtung mit Sandstrand, wagen uns aber ohne Detailkarte und Beschreibung nicht durch ihre schmale, von hoher Brandung gesäumte Einfahrt. Die Spezialkarte zeigt noch eine größere Bucht im Südwesten, die sich zirka eine Meile ins Inselinnere zieht, davor lauern jedoch viele Untiefen. Trotzdem steuern wir sie an, in der Hoffnung, mit hochgeholtem Kiel in die Bucht einlaufen zu können. Als wir ankommen, hat der Wind so zugelegt, dass wir selbst unter voller Motorkraft nicht mehr weiterkommen. Uns bleibt keine Wahl: Wir müssen in die Bucht.
Eine felsengespickte Einbuchtung voller Brecher wird sichtbar, eine Art Vorhafen zur inneren Lagune. Hinter einer schmalen Flaschenhalsöffnung winkt in etwa einer Meile Entfernung ein goldgelber Sandstrand am Fuße grüner Hügel: Dort zu ankern wäre ideal. Vorsichtig arbeiten wir uns vor, überall ragen kelpbewachsene Felsklippen aus dem Wasser. Das Sturmgeheul und das Donnern und Brüllen der sich an den nahen Felsen brechenden Seen zerren an unseren Nerven. Erich steht auf dem Deckshaus, um besseren Überblick zu haben, ich am Ruder. Doch es hilft nichts, es kommt, wie es kommen muss: Nachdem wir uns an einigen Klippen erfolgreich vorbeigeschlängelt haben, kracht es! Die Freydis zittert und sitzt fest, kommt mit der nächsten Bö aber wieder frei. Wir nehmen einen neuen Anlauf und versuchen unser Glück an anderer Stelle. Ich würde mich gern in eine Schiffsecke flüchten, mir Augen und Ohren zuhalten. Doch bevor ich den Gedanken zu Ende denken kann, kracht es wieder, diesmal noch heftiger. In voller Fahrt schiebt sich das Schiff auf eine blinde Klippe und kommt nicht mehr frei.
Immerhin sind wir fast in der Bucht. Durch Klippen und Kelp ist der Schwell gebremst, sodass er uns nicht mehr viel anhaben kann. Erich stellt den Motor ab, damit das vom Propeller klein gehackte Kelp nicht die Zuleitung zur Auspuffkühlung verstopft. Unsere Chancen, in absehbarer Zeit aufzuschwimmen, stehen schlecht: Die Gezeitentafeln verraten, dass wir im Mittagshochwasser aufgelaufen sind. Das nächste Hochwasser ist in der Nacht zu erwarten. Aufgrund einer Anomalie wird das Wasser etwas höher auflaufen als mittags. Außerdem wird sich die Springtide – wir haben Vollmond – stärker bemerkbar machen. Dennoch: Bei Dunkelheit und Sturm aufzuschwimmen, ist alles andere als ein beruhigender Gedanke.
Doch bis dahin ist es noch lange. Jetzt müssen wir erst einmal das Schiff sichern. Hans und Sigi bringen mit dem Dingi zwischen zwei Sturmböen Leinen zum Ufer aus und binden sie an Krüppelbäumen fest. Zur Sicherheit ist das Dingi mit den beiden durch eine dünne Leine mit der Freydis verbunden. Stunden später, gegen 18 Uhr, ist das Wasser so weit gefallen, dass der obere Teil des Felsens, auf dem die Freydis liegt, sichtbar wird. Der Sturm hat sich mittlerweile zum Orkan entwickelt. Das Boot zittert bei jeder Bö. Der Puls ist bei allen deutlich erhöht. Erich: „Ich weiß, 25 Tonnen können nicht einfach wegwehen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die Freydis hebt gleich ab!“ Unser Dingi hebt tatsächlich ab: Wie ein Drachen steigt es aus dem Wasser und schwebt, von der Festmacherleine gehalten, über dem Cockpit. Nur mit Mühe kann es gebändigt werden. Alle Mann arbeiten fieberhaft. Wir sichern Sigi und Hans im Dingi mit einer Leine, während sie zusätzlich den Anker mit Kette auf der Rückseite der Klippe in einer Felsspalte verkanten. Inge, wie Odysseus am Mast festgebunden, ruft die heranrasenden Böen rechtzeitig aus, die am hoch gischtenden Wasser zu erkennen sind. Immer wenn sie ruft, werfen wir uns aufs Deck, und die beiden Männer auf den Klippen klammern sich an die Kette.
Eine Schreckensnacht liegt vor uns. Vor allem Erich steht unter Druck: Obwohl die Crew dem unerlaubten Inselabstecher zugestimmt hat, trägt er als Skipper doch die volle Verantwortung! Alle halbe Stunde steht er auf und hält Ausschau.
Er malt sich aus, dass nach dem Frontdurchlauf – die Tiefs ziehen in dieser Region normalerweise rasch durch und wir rechnen bereits in der Nacht mit einer Winddrehung von Nordwest auf Südwest – vielleicht noch stärkere Böen einsetzen und entweder die Festmacherleine zum Land reißt oder der Anker aus der Spalte rutscht und wir auf die Klippen an Steuerbord geworfen werden. Wir würden dann zwar nicht in akute Lebensgefahr geraten und voraussichtlich würde auch die Freydis diese Karambolage überstehen, aber wir könnten nie mehr aus eigener Kraft tieferes Wasser erreichen, müssten Hilfe anfordern, mit Strafen rechnen, auf jeden Fall wäre die Reise zu Ende!
Das Wasser kommt früher als erwartet zurück. Logbuch: Um 01.00 Uhr nachts schwimmen wir auf, hängen nun vor Anker mit 30 Metern Kette und 30 Metern 25-mm-Ankertrosse sowie an der Schwimmleine zum Ufer. Wind aus Nordwest mit zwölf Beaufort. 02.00 Uhr: Der Orkan hat vorübergehend etwas nachgelassen, seine Richtung aber nicht geändert und legt nun wieder zu. Das Baro fällt und fällt.
02.30 Uhr: Wir verlängern die Ankerkette um weitere 30 Meter, da wir der Leine nicht mehr trauen. Temperatur deutlich kälter, richtiger Sturz.
Obwohl wir alle unter Anspannung stehen, bleibt unser Umgangston doch sehr freundschaftlich. Besonders Hans mit seiner lockeren Art hellt die Stimmung auf. Ihm scheint jede Strapaze recht, wenn er nur ums Kap Hoorn kommt. Das wollen auch unsere beiden Psychologinnen, denen die Unsicherheit zwar sichtlich zusetzt, die aber besonnen mit der Situation umgehen. Sigi, von Natur aus ein ruhiger Typ, lässt sich wenig anmerken, während Inge oft still vor sich hin weint. Später schreibt sie ein Gedicht über diese Tage:
„Sturm, heulend,
unerträglich sich steigernd,
werde ich klein unter ohnmächtiger Angst.
Schutzsuchend an deiner Schulter,
weggestoßen durch deine eigene Angst,
ergebe ich mich und weine.“
Noch wissen wir nicht, dass zu diesem Zeitpunkt auch Lona, Nils und Carsten mit ihrer Celtic nicht weit von uns entfernt auf einem Ankerplatz in den feuerländischen Kanälen in schwere Bedrängnis geraten sind. Verzweifelt kämpfen sie gegen eine Strandung ihres Schiffes, wobei ihnen der Sturm den Windgenerator aus der Halterung reißt. Sie sind so geschockt, dass sie anschließend ihre geplante Kap Hoorn-Umrundung nicht vollenden, sondern auf kürzestem Weg an der argentinischen Küste entlang nach Norden segeln.
Der Blick hinaus in die Nacht offenbart ein brodelndes Chaos hoch aufschäumender Wassermassen. Wehe dem, der jetzt draußen auf See ist! Der Wind hat seine Richtung noch immer nicht geändert, völlig atypisch für diese Region. Im Nachhinein sind wir geradezu dankbar, dass wir bei dem Orkan hoch und trocken saßen – wer weiß, was sonst alles passiert wäre.
Am Morgen dann etwas Sonne, blauer Himmel. Ab und zu besucht uns ein mutiger Magellanpinguin am Boot. Gerädert von dem ständigen Sturm, der nun auch noch mit Hagel- und Regengüssen aufwartet, schlafen wir abwechselnd über Tag. Erst gegen Abend sind wir wieder alle ansprechbar. Hans und Sigi bringen eine weitere Leine an Land aus. Inge findet das Sturmgeheul unerträglich. Um sich abzulenken, räumt sie die Kombüse auf und kocht uns eine warme Suppe. Das Baro fällt weiter. Die nächste grauenvolle Nacht naht.
Vollmond hinter schwarzen, dahinjagenden Wolkenfetzen, Sturmgeheul, Brandungsgetöse, prasselnde Hagelschauer und immer noch diese entsetzlichen Hammerböen, die unsere Freydis wie ein Spielzeugschiffchen auf die Seite packen. Die Front scheint uns zwar endlich passiert zu haben, der Wind hat auf West gedreht, doch die Festmacherleinen bleiben zum Zerreißen gespannt. Geben sie dem Druck nach, sitzen wir sofort auf den Felsen, die überall um uns herum auf der Lauer liegen.
Dicht gedrängt sitzen wir am Morgen im offenen Deckshaus, das uns gegen Wind und Regen schützt und doch unmittelbar am Geschehen unserer Umgebung teilhaben lässt. Ein Skuapärchen beäugt neugierig unseren Frühstückstisch und bemüht sich, im Flug die zugeworfenen Brocken aufzuschnappen. Aber die Böen machen selbst den Experten einen Strich durch die Rechnung: Brocken und Skuas landen meist im Wasser. Aus dem Kelpgürtel am Eingang taucht immer wieder ein riesiger schwarzer Kopf mit großen Kulleraugen auf. Erich warnt die Damen in der Achterkammer vor dem „Spanner“, der sich bald darauf als kapitaler Seelöwenbulle enttarnt. Wir taufen ihn Oskar. Die zwei Seeotter – Max und Moritz – scheinen uns dagegen gar nicht wahrzunehmen, so unbekümmert frech spielen sie auf den umliegenden Klippen Fangen. Und die scheuen Dampfschiffenten halten sowieso auf Diskretion. „Es ist hier wie im Zoo, nur dass wir die Eingesperrten sind“, freut sich Inge, sichtlich aufgemuntert von den tierischen Attraktionen.
Mit einer Miene, die „Miss Marple“ gut zu Gesicht gestanden hätte, erklärt Elisabeth beim Nachmittagstee: „Oskar ist ein Massenmörder!“ Und dann sehen wir es mit eigenen Augen: Im Kelpdickicht des Buchteinganges lauert er Pinguinen auf, schnappt sie, schlägt sie aufs Wasser und frisst einige seiner Opfer. Die anderen überlässt er – tot oder lebendig – einer Meute von Riesensturmvögeln, die das Schlachtfest vollenden. Max und Moritz genießen währenddessen „Brotzeit“ auf Otternart: Auf dem Rücken im Wasser schwimmend, knacken sie die vom Grund heraufgeholten Muscheln zwischen den Pfoten und schlürfen und lecken sie aus.
Gegen Abend dieses zweiten Tages setzt sich die Sonne durch und die Böen lassen nach. In die Mannschaft kommt Leben. Freudig rüsten wir alle zum ersten Ausflug an Land: Ein Spaziergang wird es nicht. Der Boden ist aufgeweicht und glitschig, Gras und Büsche bilden einen dichten Minidschungel und jeder Schritt kostet Kraft. Einer von uns versackt in einem Loch, ein zweiter fällt auf den Bauch, ein dritter auf den Rücken. Ein paar Graurallen schauen unseren lächerlichen Insel-Enterversuchen gelassen zu. Natürlich müssen wir aufgeben und uns stattdessen am steilen, felsigen Ufer entlanghangeln. Ein Otter zeigt uns zwar, wie’s gemacht wird – aber der steckt auch nicht in voller Segelmontur! Dass sich die Magellanpinguine auch nicht geschickter anstellen, schafft Sympathie. Einer stolpert sogar über Elke, die sich zu einer Verschnaufpause in die Sonne gelegt hat. Wären doch alle Hindernisse so weich! Trotzdem kehren wir fröhlich und beglückt vom gemeinsamen Erlebnis bei einbrechender Dunkelheit zurück an Bord. Das Baro bleibt im Keller. Die Nacht über und auch den ganzen nächsten Tag wechselhaftes Wetter mit Sturm- und Hagelböen sowie sintflutartigen Regenfällen. Lufttemperatur mittags im Cockpit +3 °C: Hochsommer in Feuerland!
Während Hans und Inge es vorziehen, an Bord zu bleiben, wagen wir wieder einen Landausflug, diesmal zur anderen Seite der Bucht. Dort stecken wir allerdings auch nach 50 Metern im mannshohen Gestrüpp fest. Von wegen zur Außenseite wandern und dort wie verheißen zu den Kolonien von Felsenhüpferpinguinen, Sturmvögeln und Albatrossen! Nur der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt: Die Silhouette im Südwesten der Insel erinnert an eine große Burg mit hohem Turm und Kuppeln – oder vielleicht doch eher an Alcatraz? Auf der Rückfahrt werden wir in die raue Wirklichkeit zurückgeholt: Wegen des vielen Kelps lässt sich der Außenborder nicht einsetzen, mit den Riemen aber kommen wir nicht gegen den Wind an. Während der Böen müssen wir uns mit aller Kraft an den Kelpstrünken festklammern, um nicht geradewegs aus der Bucht hinaus aufs offene Meer geblasen zu werden. „Hans wäre bestimmt sauer, wenn wir jetzt ohne ihn ums Kap Hoorn gehen!“, brüllt Elisabeth, halb lachend, halb weinend, gegen den Wind an. Als die Bö endlich nachlässt, rudern wir eilig zurück zum Ufer. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das Dingi in einem langen, anstrengenden Marsch am Ufer entlang nach Luv zu treideln. Die Nacht bricht schon herein, als wir von dort, fast ohne Kurskorrektur, zur Freydis zurücktreiben. Hans und Inge haben sich bereits Sorgen um uns gemacht. Einsatzbereit stehen sie mit dem „Lasso“ an der Reling, um uns notfalls einzufangen. Aber die Peilung stimmt. Hans freut sich, dass wir seine Mütze, die ihm nachts vom Kopf geweht ist, an Land wiedergefunden haben. Erich behauptet steif und fest, er habe sie Oskar abgenommen.
Am 16. Januar, nach vier stürmischen Tagen in der Bucht, hat sich der Wind so weit gelegt, dass wir beschließen auszulaufen. Wir klaren das Boot auf und sammeln Anker, Kette und Festmacherleinen ein. Als wir die Freydis zwischen den Stolpersteinen hindurchlavieren wollen, setzt uns die Strömung gleich wieder auf einen drauf. Zum Glück können wir sie mithilfe einer zum Ufer ausgebrachten Leine rasch herunterwinschen. Dann kehren wir der Orkanbucht den Rücken.
Draußen empfängt uns gewaltiger Seegang und eine Mordsbrandung an der Küste, von der wir so schnell wie möglich sicheren Abstand zu gewinnen suchen. Das Baro krebst noch immer auf 987 Hektopascal herum, Tendenz leicht fallend. Starkwind und Regenböen lassen uns keine Ruhe. Unter Groß und ausgebaumter Genua segeln wir zurück ins offizielle Fahrwasser der Kanäle Feuerlands, zunächst in den Brecknock-Sund. An dessen Ende finden wir einen Ankerplatz im Schutz einer kleinen Insel. Nach einem gemütlichen Nachtessen unter Deck – auch der Skipper hat sich zur Entspannung ein paar Bier genehmigt – orgeln plötzlich wieder einmal Fallböen von solcher Stärke auf uns herab, dass die Ankerkette nicht aufhört zu rumpeln. Erich stürzt den Niedergang hoch, sieht durch die Finsternis eine Klippenwand auf sich zukommen und brüllt: „Anker auf!“, zündet den Motor und schlägt das Ruder ein. Jeder Handgriff sitzt – die Crew ist nicht umsonst durch die harte Isla-Noir-Schule gegangen! Binnen weniger Minuten tasten wir uns, noch immer angespannt, langsam unter Maschine und mit Scheinwerferlicht aus dem ungastlichen Ort in den Paso Aguirre hinein. Wie oft haben wir so etwas in Feuerland nun schon erlebt oder von anderen Yachten gehört! Mit genügend Kette glaubt man sicher zu liegen, und dann hat der Anker auf den kelpüberzogenen, glitschigen Felsen überhaupt nicht gefasst und beim ersten Williwaw beginnt das Schiff zu treiben.
Von dubiosen Ankerplätzen haben wir die Nase endgültig voll und segeln trotz Müdigkeit die ganze Nacht durch. Im Brazo Noroeste, dem nördlichen Arm des Beagle-Kanals, in dem die in die Darwin-Kordillere einschneidenden Fjordarme alle vor imposanten Gletscherzungen enden, fühlen wir uns schon beinahe heimisch, so oft haben wir ihn besucht, und jedes Mal zieht es uns mit Macht wieder dorthin. Schon Darwin war von dieser Szenerie fasziniert: „Die hohen Berge an der nördlichen Seite bilden das Rückgrat des Landes und steigen kühn bis zu einer Höhe von drei- bis viertausend Fuß an, mit einem Pik von über sechstausend Fuß. Sie sind mit einem Mantel ewigen Schnees bedeckt, und zahlreiche Wasserfälle ergießen das Wasser durch die Wälder in die schmalen Kanäle darunter.“
Wir biegen ab in unseren mehrfingrigen Lieblingsfjord zwischen Seno Ventisquero España und Seno Ventisquero Romanche. In der Karte trägt er noch immer keinen Namen, obwohl wir ihn doch schon vor zehn Jahren „Seno Freydis“ getauft haben! Wenigstens werden wir durch eine Abordnung von Seelöwen begrüßt, die auf einem glatt polierten Felsen am Ende einer Barre Posten bezogen haben – wenn auch in gewohnt kaltschnäuziger Manier. An den Ufern und Felssimsen wachsen schlanke Buchen, Zypressen und Myrten, und tief im Inneren verzaubert das gleißend weiße, von Nebelschwaden geheimnisvoll verschleierte Nirwana einer gewaltigen Gletscherzunge die Landschaft ringsum.
Völlig erschöpft fallen wir in einen tiefen Schlaf. Nur Hans findet keine Ruhe, kann diese schöne kleine Bucht – unser Ankerplatz liegt in einer lauschig grünen Nische mit Strand und Wasserfall – nicht so recht genießen. Er bangt um seine Kap Hoorn-Umsegelung. Durch das Forte im Ancon sin Salida und das Fortissimo auf der Isla Noir ist die Zeit weggelaufen und die Fahrt zu dem berüchtigten Felsen am südlichen Zipfel Amerikas kaum noch zu schaffen. „Was soll ich meinen Enkeln erzählen?“, jammert er und entrüstet sich, als Erich ihm ersatzweise die Kap-Bilder früherer Reisen anbietet: „Sie sollen nicht mit einer Urlüge aufwachsen!“
Da kommt mir eine Idee: Vor 16 Jahren haben wir auf der Rückreise von der Antarktis eine Abkürzung zum Beagle-Kanal gewählt, und zwar durch den engen Murray-Kanal. Erst viel später haben wir erfahren, dass das nicht erlaubt ist. Dieser Wasserweg ist von den Chilenen für alle ausländischen Schiffe gesperrt worden, eine Maßnahme, die wohl vor allem die Argentinier treffen sollte, mit denen die Chilenen sich in dieser Region jahrzehntelang um Grenzen und Inseln gestritten haben und denen dadurch der direkte Zugang zum offenen Meer verwehrt ist. Doch wer sagt uns, dass das immer noch so ist? In der Karte lässt sich jedenfalls kein entsprechender Vermerk finden. Der Weg ums Kap Hoorn ließe sich auf diese Weise erheblich verkürzen.
[…]
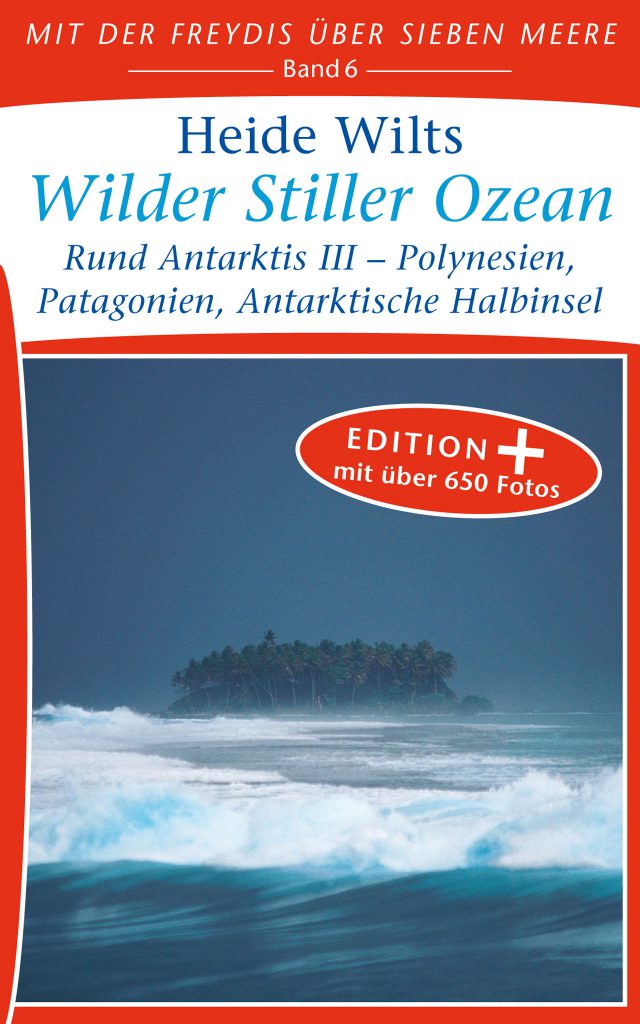








 Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever
Blauwasser.de – Judith und Sönke Roever Literaturboot.de – Detlef Jens
Literaturboot.de – Detlef Jens